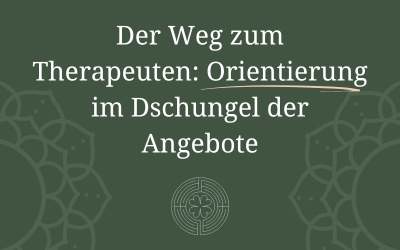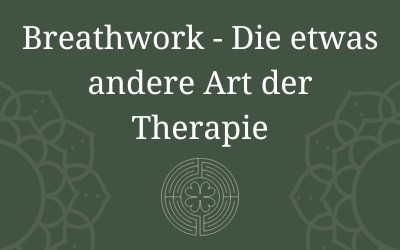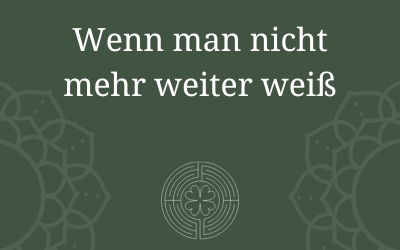„So schlimm ist es doch gar nicht.“
„Andere haben es viel schwerer.“
„Ich müsste das doch alleine hinkriegen.“
Diese Gedanken kennen viele und sie halten oft davon ab, sich Hilfe zu holen. Doch Therapie ist nicht nur für „akute Krisen“. Es kann eine große Entlastung sein, sich mit den eigenen Themen in einem geschützten Rahmen zu zeigen. In diesem Beitrag geht es darum, wann eine Therapie sinnvoll sein kann, welche Anzeichen dafür sprechen und warum es ein Zeichen von Stärke ist, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Wie oft im Alltag stellst du dir die Frage: Was brauche ich, damit es mir gut geht?
Diese Frage ist der Schlüssel zur Veränderung. Doch die Antwort darauf zu finden, ist nicht immer leicht.
Inhalt:
Die Schwierigkeit, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen:
Im Alltag funktionieren wir oft auf Autopilot. Wir arbeiten, kümmern uns um andere, erfüllen unsere Pflichten – und verlieren dabei den Kontakt zu uns selbst. Oft zeigen erst körperliche oder seelische Symptome wie Schlafprobleme, Erschöpfung oder Gereiztheit, dass etwas nicht stimmt.
Signale des Körpers deuten
Selbst dann ist allerdings nicht sofort klar, was uns unser Körper und unser Geist eigentlich genau sagen wollen. Meist haben wir schon irgendwie eine Idee, aber wissen nicht, was wir damit anfangen sollen.
Und manchmal sehen wir aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann ist es hilfreich, jemanden mit einem Blick von außen zu haben. Wenn wir in etwas drinstecken können wir nicht erkennen, was es sein soll – jemand der von außen darauf schaut aber schon.
Warum professionelle Hilfe wichtig ist
Seelische Symptome wie dauerhafter Stress, Ängste oder Depressionen sind genauso ernst zu nehmen wie körperliche Beschwerden. Genauso wie Zahnschmerzen auf ein tieferliegendes Problem hinweisen, zeigen uns diese Symptome, dass in unserem Leben etwas nicht im Gleichgewicht ist. Professionelle Hilfe bietet Werkzeuge und Perspektiven, um diese Balance wiederherzustellen.
Was in der Therapie/Beratung erarbeitet wird:
- Verständnis für dich selbst entwickeln: Warum fühlst du dich so, wie du dich fühlst? Welche Bedürfnisse stehen hinter deinen Emotionen?
- Zusammenhänge erkennen: Wie hängen Stress, Gefühle und körperliche Reaktionen zusammen? Welche Muster beeinflussen dein Verhalten?
- Einen gesunden Umgang finden: Wie kannst du auf belastende Situationen reagieren, ohne dich selbst zu verlieren? Welche Strategien helfen dir, schwierige Gefühle zu bewältigen?
- Den persönlichen Sinn entdecken: Was gibt deinem Leben Bedeutung? Warum ist es wichtig, sich mit dieser Frage zu beschäftigen?
Psychologisch/psychotherapeutisch geschulte Begleiter unterstützen dich dabei, Antworten auf diese Fragen zu finden.
Wie das aussieht und konkret umgesetzt wird ist dabei von Therapeut zu Therapeut unterschiedlich: Jeder verwendet andere Ansätze und Methoden und jeder Therapeut hat auch seinen ganz eigenen Stil – das kann von humorvoll-freundschaftlich bis hin zu distanziert-sachlich reichen.
(Eine hilfreiche Übersicht, über die grundlegenden Unterschiede und Bezeichnungen psychologischer und psychotherapeutischer Unterstützung findest du im nächsten Artikel!)
Welcher Therapeut ist nun der richtige für mich?
Grundsätzlich ist die Vorstellung, zu einem Therapeuten zu gehen, für viele Menschen nach wie vor mit viel Unsicherheit verbunden. Früher war das Thema oft komplett tabu, heute hat es glücklicherweise an Akzeptanz gewonnen. Doch die Suche nach dem richtigen Ansprechpartner kann herausfordernd sein.
Herausforderungen bei der Suche nach Hilfe
Selbst wenn man es geschafft hat, sich selbst einzugestehen, dass man allein nicht mehr weiter kommt, ist es gar nicht so einfach schnell den richtigen Therapeuten zu finden.
Die Probleme sind:
- Die Vielfalt der Angebote:
Der Markt bietet viele Optionen: Psychologische Psychotherapeutinnen, ärztliche Psychotherapeutinnen, Heilpraktikerinnen für Psychotherapie, pychologische Berater, Coaches… – jeder mit anderen Schwerpunkten und Qualifikationen. - Die Methodenvielfalt:
Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Schematherapie, Gestalttherapie, Neurolinguistisches Programmieren uvm. – die Vielzahl an Ansätzen kann verwirrend sein, besonders für Laien. - Lange Wartezeiten:
Die Nachfrage nach kassenfinanzierten Therapieplätzen ist hoch, und oft dauert es Wochen oder Monate, bis man einen Therapieplatz bekommt.
Wie finde ich den richtigen Therapeuten?
Die Wahl des passenden Therapeuten hängt von mehreren Faktoren ab.
Eine wichtige Frage ist: Was möchte ich erreichen?
Geht es um die Behandlung konkreter Symptome oder darum, einen bestimmten Lebensbereich zu verändern? Auch der persönliche Leidensdruck und der Anlass für die Suche nach Unterstützung spielen eine große Rolle.
Die Beziehung muss stimmen! Therapie wirkt am besten, wenn man sich wohl und verstanden fühlt. Deshalb lohnt es sich, den eigenen Typ zu reflektieren: Bin ich eher sachlich, effizient und rational oder verspielt und mystisch interessiert? Welche Ansätze und Methoden sprechen mich an?
Selbst zahlen oder Kasse?
Wer eine kassenfinanzierte Therapie möchte, muss sich nach zugelassenen Therapeuten umsehen, oft mit langen Wartezeiten.
Selbstzahler haben mehr Auswahl und sind flexibler. Sie bestimmen selbst, welche Art von Unterstützung sie möchten.
Zudem bleibt die Therapie vollkommen privat, ohne dass eine Krankenkasse oder andere Stellen davon erfahren. Gerade für Menschen, die Wert auf Diskretion legen oder sich nicht nach vorgegebenen Diagnosen richten möchten, kann das ein großer Vorteil sein.
Viele Therapeut*innen bieten unverbindliche Erstgespräche an – eine gute Gelegenheit, um herauszufinden, ob die Zusammenarbeit passt. Hier kann man prüfen, ob die Chemie stimmt und die Herangehensweise den eigenen Bedürfnissen entspricht.
Eine grundsätzliche Übersicht zu psychotherapeutischen Angeboten und Möglichkeiten findest du in dem Artikel „Therapieplatz gesucht? Orientierung im Dschungel der Angebote“!